Wie hoch sollten die Servicegebühren für Web3-Plattformen sein?
Gebühren sind keineswegs nur ein reines Abzugsmittel, sondern können auch als ein Koordinationsmechanismus dienen.
Gebühren sind keineswegs nur ein einfaches Mittel zur Gewinnabschöpfung, sondern können auch als ein Koordinationsmechanismus dienen.
Verfasst von: Gérard Cachon, Tolga Dizdarer, Gerry Tsoukalas
Übersetzung: Luffy, Foresight News
Web3 zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Intermediären zu verringern, um Servicegebühren zu senken und den Nutzern eine stärkere Kontrolle über ihre eigenen Daten und Vermögenswerte zu geben. Zum Beispiel bietet Gensyn (eine dezentrale KI-Computing-Plattform) KI-Rechenleistungen zu einem Bruchteil der Kosten von Amazon Web Services (AWS) an; Drife (eine dezentrale Mobilitätsplattform) verspricht, Fahrern zu helfen, sich von den bis zu 30% Provisionen von Uber zu befreien.
Obwohl das Ziel, die Kosten für Nutzer zu senken, sehr attraktiv ist, erfordert die Festlegung angemessener Gebühren- und Preisstandards, dass die Plattform ein Gleichgewicht zwischen den Interessen verschiedener Parteien findet. Die erfolgreichsten dezentralen Marktplätze verzichten keineswegs vollständig auf Gebühren, sondern kombinieren „dezentrale Preisgestaltung“ mit einer durchdachten, wertschöpfenden Gebührenstruktur, um so ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen.
Basierend auf unserer Forschung erläutert dieser Artikel Folgendes: die Rolle der Preiskontrolle und Gebührenstruktur in der Plattformökonomie und -governance; warum das „Null-Gebühren“-Modell, egal wie gut die Absichten der Designer sind, letztlich zum Scheitern verurteilt ist; und wie Blockchain-Plattformen Preisstrategien entwickeln sollten. Wir schlagen ein neues, auf Handelsvolumen basierendes „affines Preismodell“ vor, das den Widerspruch zwischen privaten Informationen und Marktkollaboration lösen kann.
Warum Preise und Gebühren wichtig sind
Der Aufstieg und Fall digitaler Plattformen hängt von ihrer Fähigkeit ab, zwei zentrale Hebel zu steuern: Preiskontrolle und Gebührenstruktur (also wie viel die Plattform von Käufern und Verkäufern, die ihre Dienste nutzen, verlangt). Diese beiden sind nicht nur Werkzeuge zur Einnahmenerzielung, sondern auch Marktdesign-Instrumente, die das Nutzerverhalten formen und die Marktergebnisse bestimmen.
Die Preiskontrolle bestimmt, „wer den Transaktionspreis festlegt“. Zum Beispiel setzt Uber Fahrpreise durch einen zentralisierten Algorithmus fest, um Angebot und Nachfrage auszugleichen und Preisstabilität zu optimieren; im Gegensatz dazu gibt Airbnb den Gastgebern die Preisautonomie und steuert sie nur moderat durch algorithmische Empfehlungen. Beide Modelle haben unterschiedliche Schwerpunkte: Zentralisierte Preisgestaltung gewährleistet Koordinationseffizienz in groß angelegten Märkten; dezentralisierte Preisgestaltung ermöglicht es Dienstleistern, private Informationen (wie Kosten, Servicequalität, Differenzierungsvorteile usw.) in ihre Preisstrategie einzubeziehen. Es gibt kein absolutes Besser oder Schlechter, die Wirksamkeit hängt vom jeweiligen Anwendungsszenario ab.
Die Gebührenstruktur beeinflusst nicht nur die Einnahmen der Plattform, sondern bestimmt auch, welche Teilnehmer in den Markt eintreten und wie der Markt funktioniert. Der Apple App Store erhebt eine Provision von bis zu 30%, die sowohl zur Auswahl hochwertiger Apps als auch zur Finanzierung der Plattforminfrastruktur dient, aber auch zu Unmut bei Entwicklern führen kann, ohne jedoch die Nutzer direkt zu beeinflussen; im Gegensatz dazu treiben hohe Gebühren bei Ticketplattformen wie Ticketmaster Künstler und Fans zu alternativen Kanälen, sofern diese verfügbar sind. Am unteren Ende der Gebühren führen kostenlose Angebote wie bei Facebook Marketplace zu Betrugsproblemen; mehrere nahezu gebührenfreie NFT-Plattformen haben durch den Zustrom von minderwertigen NFTs das Nutzererlebnis beeinträchtigt.
Das Muster ist offensichtlich: Zu hohe Gebühren führen zum Verlust von Anbietern; zu niedrige Gebühren schaden der Qualität von Dienstleistungen oder Produkten.
Viele Blockchain-Projekte setzen auf ein Null-Provisionsmodell, mit der Logik: Wenn die Plattform auf Wertabschöpfung verzichtet, profitieren Anbieter und Nutzer gleichermaßen. Diese Sichtweise verkennt jedoch die entscheidende Rolle „angemessen gestalteter Gebühren“ für das effektive Funktionieren des Marktes: Gebühren sind keineswegs nur ein einfaches Mittel zur Gewinnabschöpfung, sondern können auch als ein Koordinationsmechanismus dienen.
Der Ausgleich zwischen Information und Koordination
Der zentrale Widerspruch im Plattformdesign besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der „Nutzung privater Informationen der Dienstleister“ und der „Koordination des Marktes zur Effizienzsteigerung“ zu finden. Unsere Forschung zeigt, dass die Interaktion zwischen Preiskontrolle und Gebührenstruktur darüber entscheidet, ob dieser Widerspruch gelöst oder verschärft wird.
Wenn die Plattform die Preise direkt festlegt, kann sie zwar leichter Koordination auf der Angebotsseite und Wettbewerb zwischen Dienstleistern erreichen, aber da sie die privaten Kosten jedes Anbieters (wie Betriebskosten, Grenzkosten usw.) nicht kennt, führt die Preisgestaltung oft zu einer Fehlallokation zwischen Angebot und Nachfrage: Für einige Nutzer sind die Preise zu hoch, für einige Anbieter zu niedrig. Da die Plattform in der Regel eine Provision auf den Transaktionsbetrag erhebt, führt diese ineffiziente Preisgestaltung letztlich zu Gewinnverlusten.
Wenn die Dienstleister ihre Preise selbst festlegen, können diese theoretisch die tatsächlichen Kosten und Fähigkeiten widerspiegeln: Anbieter mit niedrigen Kosten können durch Preissenkungen Wettbewerbsvorteile erzielen und so eine bessere Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage sowie Markteffizienz erreichen. Doch ein unkoordiniertes Preismodell kann in zwei Aspekten kontraproduktiv sein.
Bei starker Homogenität von Produkten oder Dienstleistungen kommt es leicht zu einem Preiskampf. Anbieter mit hohen Kosten werden gezwungen, den Markt zu verlassen, was das Angebot reduziert; gleichzeitig steigt die Nachfrage, was letztlich die Fähigkeit der Plattform schwächt, den Markt zu bedienen. Während der durchschnittliche Preis sinkt und Verbraucher profitieren könnten, wird das Provisionsmodell der Plattform direkt beeinträchtigt.
Wenn Produkte oder Dienstleistungen kombiniert werden müssen, um ihren maximalen Wert zu entfalten, neigen Anbieter dazu, zu hohe Preise festzulegen. Obwohl viele Anbieter auf die Plattform strömen, treiben die von ihnen festgelegten hohen Preise den Marktpreis nach oben und vertreiben letztlich die Nutzer.
Dies ist keine rein theoretische Annahme: Im Jahr 2020 testete Uber in Kalifornien das „Luigi-Programm“, das Fahrern die Preisautonomie ermöglichte. Das Ergebnis zeigte, dass die von den Fahrern festgelegten Fahrpreise im Allgemeinen zu hoch waren, was dazu führte, dass die Nutzer zu anderen Mobilitätsplattformen wechselten. Das Programm wurde nach etwa einem Jahr eingestellt.
Schlüssel-Erkenntnis: Die oben genannten Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Gleichgewichtsergebnis unter Standard-Provisionsverträgen. Selbst wenn der Provisionsvertrag optimiert wird, kann es weiterhin zu solchen anhaltenden Marktversagen kommen. Daher ist die Kernfrage nicht „Wie viel Provision sollte die Plattform verlangen“, sondern „Wie sollte die Gebührenstruktur gestaltet sein, damit der Markt für alle Teilnehmer effektiv ist“.
Wie das Problem gelöst werden kann
Unsere Forschung zeigt, dass eine gezielte Gebührenstruktur das Problem der Marktkollaboration geschickt lösen kann und gleichzeitig die Vorteile der „individualisierten Preisgestaltung“ bewahrt. Dieses affine Gebührenmodell verwendet einen „zweiteiligen Gebührenmechanismus“, bei dem Dienstleister der Plattform Folgendes zahlen müssen:
- Eine feste Grundgebühr pro Transaktion;
- Eine variable Gebühr: Sie steigt mit zunehmendem Transaktionsvolumen (Zuschlag) oder sinkt mit zunehmendem Transaktionsvolumen (Rabatt).
Dieses Modell wirkt sich je nach Kosten und Marktpositionierung unterschiedlich auf die Anbieter aus.
In solchen Märkten gibt es erhebliche Kostenunterschiede zwischen den Anbietern: Einige Anbieter haben aufgrund fortschrittlicherer Technologien, Zugang zu erneuerbaren Energien oder effizienter Kühlung von Natur aus niedrigere Kosten; andere Anbieter haben zwar höhere Kosten, können aber Premium-Dienste wie hohe Zuverlässigkeit anbieten.
Im traditionellen Provisionsmodell setzen bei übermäßigem Wettbewerb Anbieter mit niedrigen GPU-Kosten aggressive Niedrigpreise fest und erlangen einen zu großen Marktanteil, was zu den oben genannten Marktverzerrungen führt: Einige Anbieter ziehen sich zurück, was das Transaktionsvolumen begrenzt, während der durchschnittliche Marktpreis sinkt.
Für dieses Szenario ist die optimale Strategie ein „Transaktionsvolumen-Zuschlag“: Je mehr Kunden ein Anbieter bedient, desto höher ist die Gebühr pro Transaktion.
Dieser Mechanismus setzt „natürliche Grenzen“ für aggressive Anbieter mit niedrigen Kosten und verhindert, dass sie mit nicht nachhaltigen Niedrigpreisen zu viel Marktanteil gewinnen, wodurch das Marktgleichgewicht gewahrt bleibt.
Bei moderatem oder unzureichendem Wettbewerb ist die optimale Strategie ein „Transaktionsvolumen-Rabatt“: Je mehr Kunden ein Anbieter bedient, desto niedriger ist die Gebühr pro Transaktion. Dieser Mechanismus motiviert Anbieter, durch Preissenkungen das Transaktionsvolumen zu erhöhen und so die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu steigern, ohne dass die Preise unter ein nachhaltiges Niveau fallen.
Beispielsweise kann auf dezentralen sozialen Plattformen für „Schöpfer mit höherem Nutzerengagement“ eine niedrigere Gebühr erhoben werden, um sie zu ermutigen, wettbewerbsfähigere Preise für kostenpflichtige Inhalte festzulegen und gleichzeitig mehr Nutzer zur Teilnahme zu bewegen.
Das Raffinement des affinen Gebührenmechanismus liegt darin, dass die Plattform nicht die spezifischen Kosten jedes Anbieters kennen muss; die Gebührenstruktur schafft positive Anreize und führt dazu, dass Anbieter sich entsprechend ihrer privaten Kosteninformationen selbst regulieren. Anbieter mit niedrigen Kosten können weiterhin durch niedrigere Preise als ihre teureren Konkurrenten Vorteile erzielen, aber die Gebührenstruktur verhindert, dass sie den Markt auf eine Weise monopolisieren, die dem gesamten Ökosystem schadet.
Unsere mathematischen Simulationen zeigen: Eine angemessen kalibrierte „auf Transaktionsvolumen basierende Gebührenstruktur“ ermöglicht es der Plattform, mehr als 99% der theoretisch optimalen Markteffizienz zu erreichen. Im theoretischen Rahmen übertrifft sie sowohl „zentralisierte Preisgestaltung“ als auch „Null-Provision“-Modelle deutlich. Der resultierende Markt weist folgende Merkmale auf:
- Anbieter mit niedrigen Kosten behalten ihren Wettbewerbsvorteil, ohne einen übermäßigen Marktanteil zu erlangen;
- Anbieter mit hohen Kosten können weiterhin durch Fokussierung auf „Nischenmärkte für differenzierte Dienstleistungen“ teilnehmen;
- Der Gesamtmarkt erreicht einen ausgewogeneren Gleichgewichtszustand mit angemessenen Preisunterschieden;
- Die Plattform verbessert die Marktleistung und erzielt gleichzeitig nachhaltige Einnahmen.
Darüber hinaus zeigt die Analyse: Die optimale Gebührenstruktur hängt von „beobachtbaren Markteigenschaften“ ab und nicht von den „privaten Kosteninformationen“ jedes Anbieters. Bei der Vertragsgestaltung kann die Plattform „Preis“ und „Transaktionsvolumen“ als beobachtbare Indikatoren für „verdeckte Kosten“ verwenden, sodass Anbieter die Preiskontrolle auf Basis privater Informationen behalten und gleichzeitig das inhärente Koordinationsversagen vollständig dezentraler Systeme gelöst wird.
Zukünftige Entwicklungspfade für Blockchain-Projekte
Viele Blockchain-Projekte schaden durch die Anwendung traditioneller Provisionsmodelle oder Null-Gebühren-Modelle sowohl ihrer eigenen finanziellen Nachhaltigkeit als auch der Markteffizienz.
Unsere Forschung bestätigt, dass die Gestaltung einer angemessenen Gebührenstruktur nicht im Widerspruch zur Dezentralisierung steht, sondern ein Kernelement für den Aufbau funktionierender dezentraler Märkte ist.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Bitcoin (BTC/USD) Preisalarm: Bitcoin durchbricht wichtigen Widerstand – Nächstes Ziel 100.000 $?

Bitcoins stärkster Handelstag seit Mai deutet auf eine mögliche Rallye bis zu 107.000 US-Dollar hin
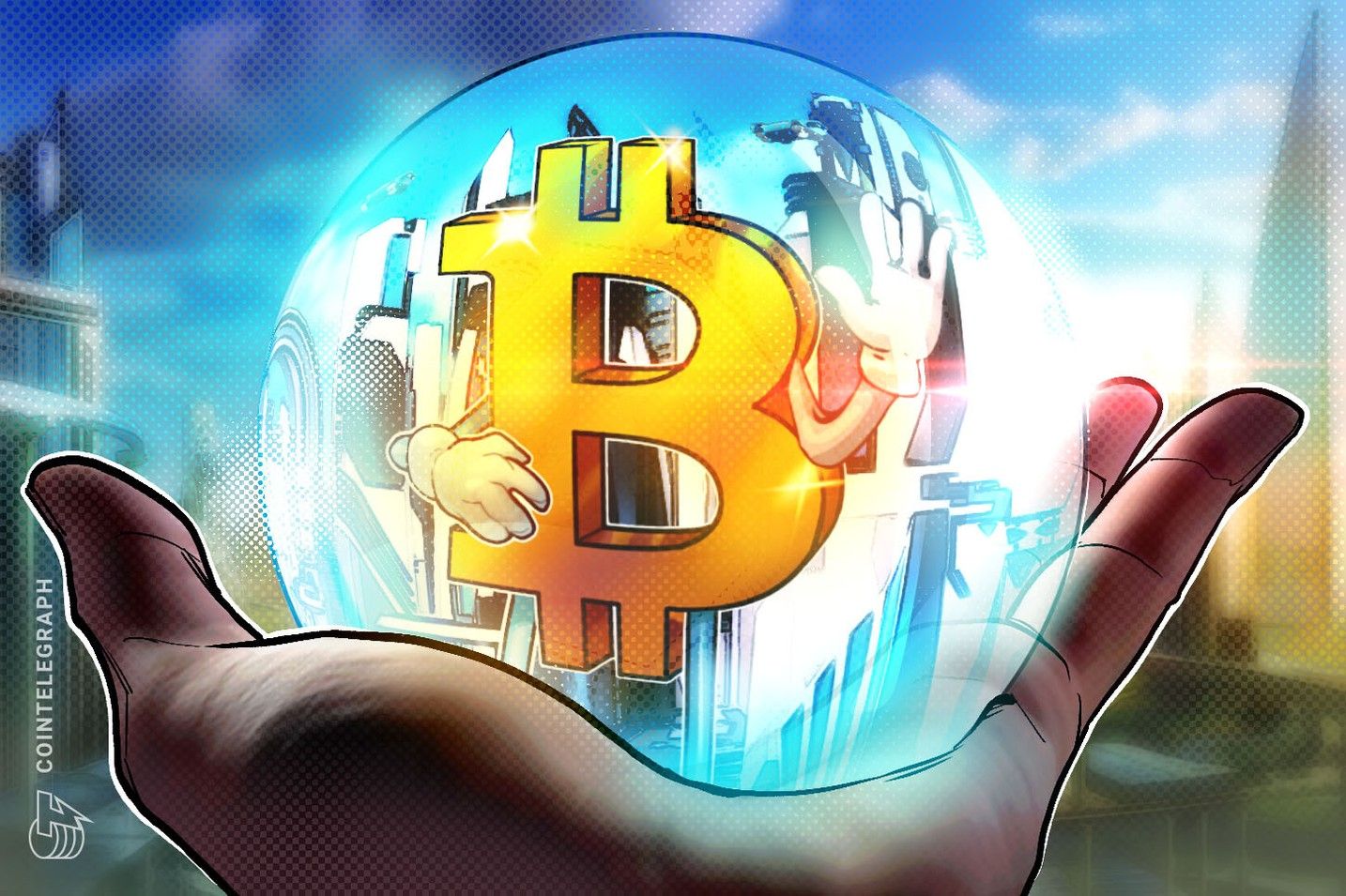
Kann der BNB-Preis im Dezember wieder die 1.000-Dollar-Marke erreichen?
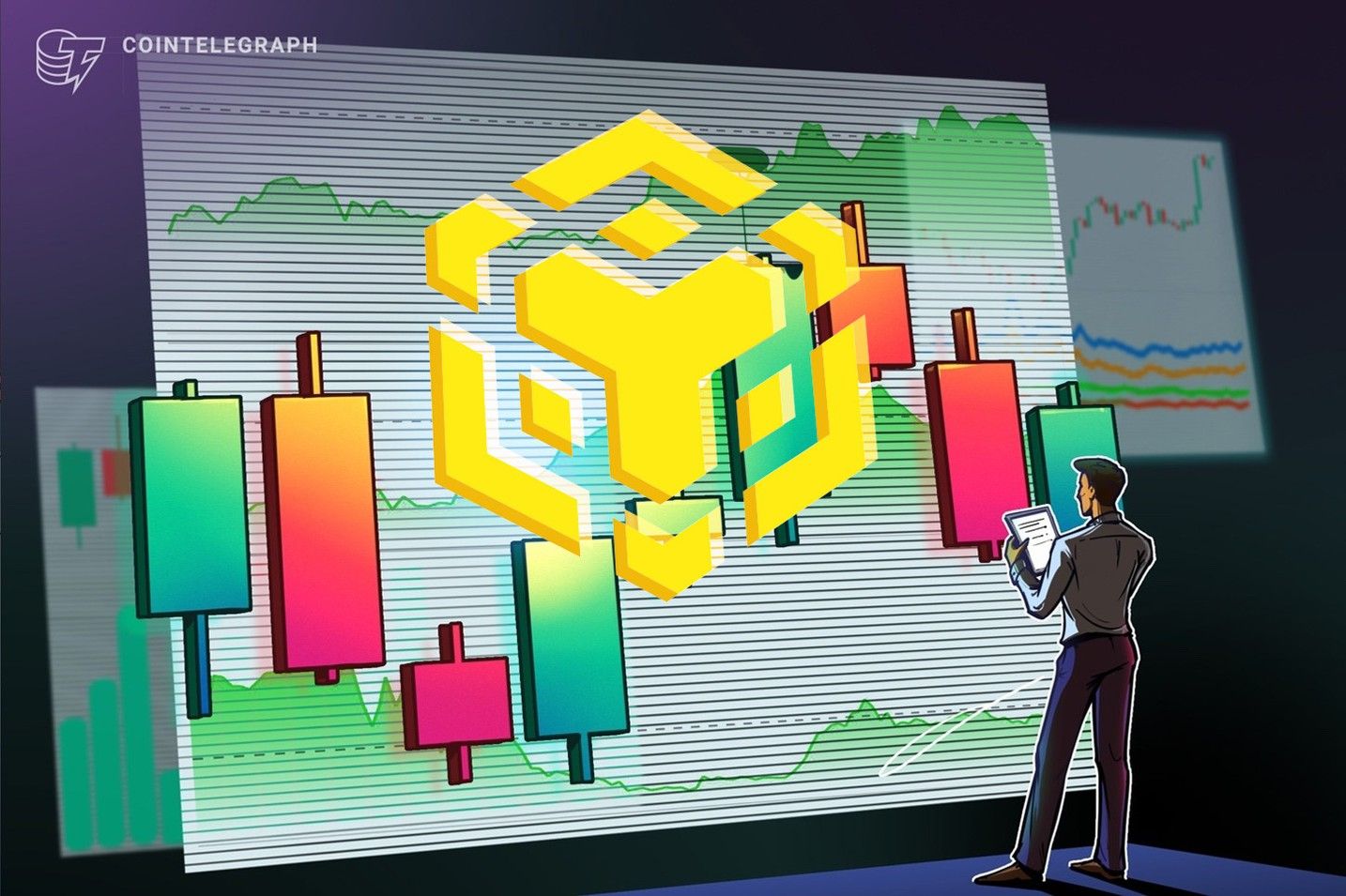
Im Trend
Mehr【Bitpush Daily News Selection】Trump deutet aktiv an, dass Hassett der nächste Vorsitzende der US-Notenbank werden könnte; Bloomberg: Strategy könnte in Zukunft Bitcoin-Kreditdienstleistungen in Betracht ziehen; Strategy CEO: Strategy richtet durch Aktienverkauf einen Reservefonds von 1,4 Milliarden US-Dollar ein, um den Verkaufsdruck auf Bitcoin zu mildern; Sony könnte einen US-Dollar-Stablecoin für Zahlungen im Gaming- und Anime-Ökosystem einführen
Bitcoin (BTC/USD) Preisalarm: Bitcoin durchbricht wichtigen Widerstand – Nächstes Ziel 100.000 $?

